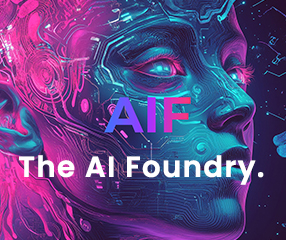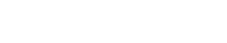
KI 2024: Ein Jahr voller Innovationen – doch Europa bleibt zurück
Das Jahr 2024 begann mit einem Marketing-Aufreger, der die gesamte Branche prägte: Künstliche Intelligenz (KI) – insbesondere im europäischen Kontext. Während OpenAI, Microsoft, Google und Adobe eine Neuerung nach der anderen auf den Markt brachten, blieb die europäische KI-Szene ins Stocken geraten. Obwohl vielversprechende Ideen vorhanden sind, hapert es an der Umsetzung. Eine Studie des Applied AI Institute for Europe zeigte zu Jahresbeginn die größten Herausforderungen europäischer KI-Startups auf: mangelnde Finanzierung (51 %), zu viel Regulierung (24 %), begrenzte Rechenleistung (19 %) und fehlendes Fachpersonal (18 %).

Europa geht eigenen Weg
Zumindest auf regulatorischer Ebene kann Europa Big Tech jedoch Paroli bieten. Mit dem AI Act, einem fast 900 Seiten starken Gesetzestext, wird die Nutzung von KI in Europa seit diesem Jahr geregelt. Die Verabschiedung durch den EU-Rat erfolgte im Frühjahr 2024, und im August trat das Gesetz in Kraft. Ziel ist es, den sicheren Umgang mit KI zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher*innen in die Technologie zu stärken. In Sachen Regulierung geht Europa also einen eigenen, klaren Weg – doch ob das reicht, um mit den internationalen Tech-Giganten mitzuhalten, bleibt abzuwarten.
Hoffnung durch Europäische Initiativen

Ein Hoffnungsschimmer liegt jedoch in der wachsenden Anzahl europäischer Initiativen, die gezielt versuchen, den Anschluss nicht zu verlieren. Kooperationen zwischen Universitäten, Industrie und staatlichen Förderprogrammen wurden 2024 weiter ausgebaut, um den Innovationsstau zu überwinden und europäische KI-Projekte zügiger auf den Markt zu bringen. Insbesondere die Bemühungen, digitale Souveränität zu stärken und eine unabhängige Infrastruktur für KI-Anwendungen aufzubauen, könnten langfristig entscheidend sein. Dennoch bleibt offen, ob diese Maßnahmen schnell genug greifen, um Europas Position im globalen KI-Wettbewerb nachhaltig zu verbessern.
Investitionen in KI ab dem Mittelstand sind unumgänglich um am Markt bis 2030 wettbewerbsfähig zu bleiben.
Marcel Dietz
Gründer & GF AIFoundry